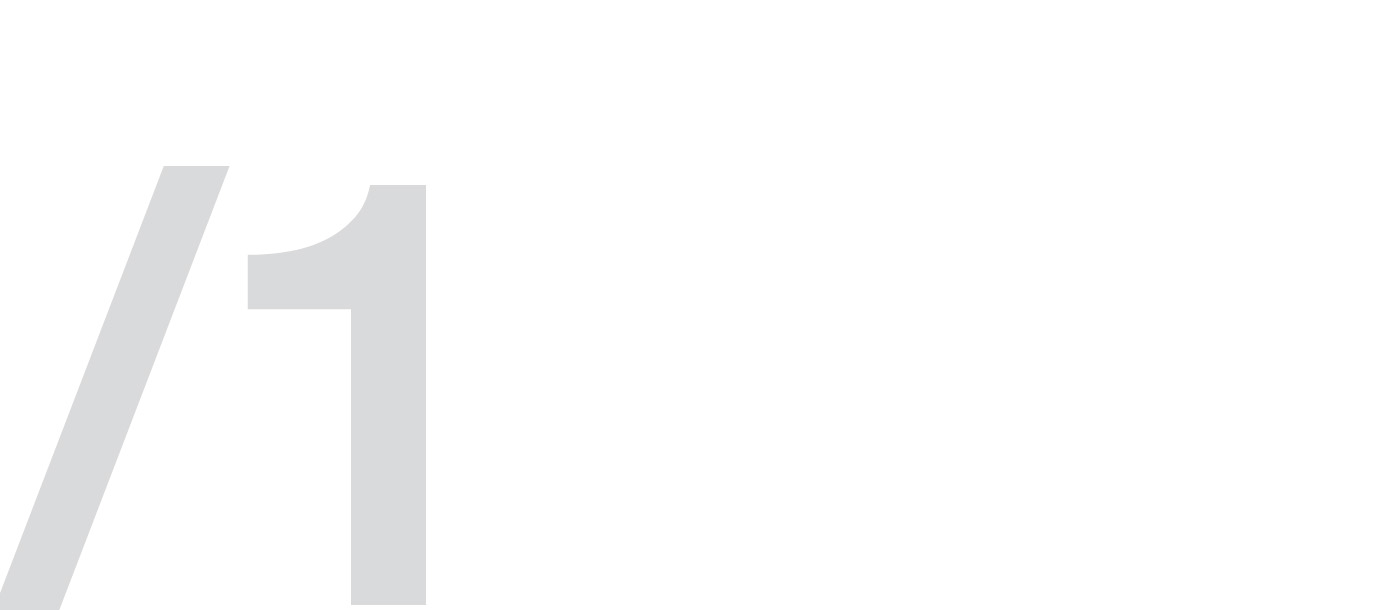blick in die Sammlung/1
23.02. - 30.06.2001
DIE LEIPZIGER SCHULE
Neun Kapitel für einen noch umstrittenen Begriff
I.
Dass in diesem Jahr die Sparkasse Leipzig eine eigene Kunsthalle eröffnet, die sich primär jener bedeutsamen Kunstentwicklung zuwendet, die sich von der Mitte des vergangenen Jahrhunderts an bis heute in der Region dieser Stadt vollzieht; und die man unter dem Begriff Leipziger Schule mit Recht zusammenfassen kann. Das ist das Ergebnis einer ganzen Reihe glücklicher Zufälle. Wobei der glücklichste sich in der Sparkasse selbst begründet, in ihrem Vorstand, und dort nicht zuletzt in dessen Vorstandsvorsitzenden Peter Jürgen Krakow. Ich stelle dies voran, weil es sich dabei eben nicht um eine Selbstverständlichkeit handelt. Und weil dergleichen Engagement nicht nur Mut und Vorausschau erfordert, sondern leider noch immer allzu selten gegeben ist.
Gewiss muss man hierbei berücksichtigen, dass es in Deutschland nicht viele Städte gibt, die in den letzten fünfzig Jahren eine vergleichbare Kunstentwicklung erlebten und daher über einen gewaltigen Fundus qualitätvollster Werke verfügen, wie Leipzig und seine Region. Also, die Einrichtung einer entsprechenden Kunsthalle fast zwingend erscheint. Sowie zusätzlich Sachsen auf eine Kulturtradition zurückblicken kann, deren Leistungen zum Besten abendländischer Kultur zählen. – Es verwundert niemanden, dass ein beherrschend großer Teil der Künstler, die nach dem Kriege in Westdeutschland die dortige Kunstentwicklung entscheidend prägten, aus Sachsen kommt.
Wie aber lässt es sich erklären, dass wir es hier nicht mit einer Allerweltserscheinung zu tun haben, sondern mit einer beachtenswerten Besonderheit, die einerseits zwar für die Welt erst noch entdeckt werden muss, andererseits aber durch die erschaubaren Werke bereits zu einem großen Teil materialisiert wurde?
II.
Es ist der sächsische Boden, den man als den ersten Verursacher benennen könnte. Denn er ist überwiegend, wie man sagt: sauer, kalt und nährstoffarm. Für die Landwirtschaft ist er nur in wenigen Gebieten des Landes geeignet. Statt dessen ist man schnell in unfruchtbaren und nicht selten rauen Mittelgebirgszonen. Diese wiederum besaßen eine Reihe von Bodenschätzen. Man war, wollte man überleben, von Anfang an darauf angewiesen, die Produkte, die sich aus den vorhandenen oder importierten Rohstoffen fertigen ließen, hochzuveredeln, denn keines der großen, den Trend bestimmenden Marktzentren lag in der Nähe: Wie zum Beispiel Paris oder Wien und später New York oder Buenos Aires. So entwickelte sich sehr früh ein beachtliches Ingenieurwesen. Welches wiederum nach wissenschaftlichem Hinterland verlangte. (Auf sächsischem Boden liegen zwei der ältesten Universitäten Deutschlands.) Und da die Produkte nicht nur funktionieren, sondern auch den jeweiligen ästhetischen Ansprüchen genügen mussten, so war auch der Künstler ein fester Bestandteil dieses Dreigestirns von: Meisterlichem Handwerk, Wissenschaft und Kunst.
Als man dann in Sachsen als erstem europäischen Land (nach den USA) 1865 die allgemeine Gewerbefreiheit einführte, schossen allerorts nicht nur Berufs- und Gewerbeschulen aus dem kargen Boden, in denen der Zeichenunterricht ein genereller, fester Bestandteil aller Ausbildungen war, es entstanden auch bedeutsame Kunstgewerbesammlungen neben den bürgerlichen Kunstsammlungen, die sich ab dem 19. Jahrhundert zu den grandiosen fürstlichen Sammlungen in Dresden gesellten. Der wirtschaftliche Aufbruch war in Sachsen also auch stets ein künstlerischer. Hatte man in seiner langen Geschichte immer wieder Großes für die europäische Kunstgeschichte beigetragen, man denke stellvertretend an den Naumburger Dom, den Dresdner Zwinger oder das Bauhaus, so hielt sich dies bis in die Gegenwart; obwohl man von einem wunderlichen Schicksal in schöner Regelmäßigkeit zu Boden geworfen wurde, weil man sich klugerweise immer aus den großen Konflikten heraushielt, um dann am Ende doch dummerweise auf der falschen Seite noch einzusteigen, auf dass man immer wieder hernach die Zeche zu zahlen hatte. Und auch nach dem zweiten Weltkrieg, wenn auch diesmal ohne eigenes Hinzutun, fand man sich bei den Verlierern wieder. Aber unberührt von allem ließ man auch in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts weiterhin von sich hören in erstaunlichem Maße. Jene sächsische Besonderheit der westdeutschen Kunstentwicklung wurde bereits angesprochen. Noch eine weitere ließe sich benennen: A. R. Penck. Die von ihm ausgelöste 9 Weltkultur der Strichfiguren nahm ihren Anfang nicht erst, als er 1980 ins Rheinland übersiedeln musste, sondern die ersten Arbeiten in diesem Sinne entstanden 1961/62 in Dresden.
III.
Nun könnte man schlussfolgern, dass dies alles auch für Leipzig gilt. Aber im Bezug zum bisher Gesagten besitzt Leipzig – im speziellen Hinblick auf bildende Kunst – eine sehr eigene Historie. Denn mit Ausnahme von Max Klinger, der um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert weltberühmt wurde, lässt sich für Leipzig weder in den Jahrhunderten davor noch in den Jahren danach bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine nennenswerte Kunstentwicklung verzeichnen. Erst nach dem zweiten Weltkrieg gelingt es Leipzig, sich neben der Hochkultur Musik auch eine Hochkultur der bildenden Kunst anzueignen. Die Stadt scheint in jenen Jahren überreif dafür zu sein. Sie explodiert förmlich, betrachtet man das Potenzial an Künstlern, die nach dem Kriege sich hier, zuerst studierend und dann lehrend oder freischaffend, als Maler und Bildhauer niederlassen. Und das, obwohl Leipzig noch bis zur Mitte der sechziger Jahre einen äußerst schlechten Ruf in Beziehung auf die bildende Kunst und insbesondere im Hinblick auf seine Kunstakademie besaß, die genau genommen zunächst auch nur eine Schule für die angewandten Künste war. Wer damals in Leipzig zum Kunststudium antrat, tat dies nicht selten, weil er in Dresden, Halle oder Berlin abgelehnt worden war. Aber das sind ja bekanntlich nicht die schlechtesten. Und als es Bernhard Heisig gelang, 1961 an dieser Schule die erste freie Malklasse einzurichten, da war diese über Nacht gefüllt mit großen Talenten, dass zuweilen nicht genau festzustellen war, wer von wem mehr profitierte: mancher Lehrer von manchem Studenten oder umgekehrt. Das ständige Nachrücken junger, talentierter Künstlerinnen und Künstler hat bis heute angehalten und auch die schweren Jahre der Wendezeit überdauert.
Für die Leipziger Entwicklung ist aber eben nicht allein die Hochschule für Grafik und Buchkunst, wie die einstige Kunstakademie nun heißt, verantwortlich. Man muss die gegebene Zweiteilung der Kunstszene in Leipzig bedenken, will man der geschehenen Kunstentwicklung gerecht werden. Es gab neben dem Kreis derer, die an der Hochschule beschäftigt waren oder studierten immer einen gleichstarken Kreis von Künstlern, die freischaffend in der Stadt lebten. Und fast die ganze Zeit hindurch herrschte zwischen beiden Kreisen eine gewisse Spannung, die zuweilen so stark war, dass sich daraus durchaus eine gegenseitige Befruchtung ergab, so wenig grün man sich ansonsten auch aus den unterschiedlichsten Gründen ist.
Trotz Differenzen gibt es zwischen beiden ein verbindendes Merkmal, auf Grund dessen sich dann auch zur Mitte der siebziger Jahre hin der Begriff „Leipziger Schule“ herausbildete: Den manche, wohl auf Grund des Wortes „Schule“, allein der Hochschule zurechnen. Das aber ist falsch. Noch 1975 verwehrt sich die Hochschule öffentlich gegen diesen Begriff, den sie ausschließlich für den Kreis der Freischaffenden in der Stadt angewandt haben will. Erst als sich dieser Begriff in sehr positiver Form zunehmend verbreitete, begann man seitens der Schule nun wiederum ihn ausschließlich für sich in Anspruch nehmen zu wollen. Dieser Begriff hat sich aber auf Grund der Tatsache herausgebildet, dass beide Leipziger Kreise sich bereits Ende der sechziger Jahre ganz auffällig dadurch von der übrigen Kunstentwicklung unterschieden, weil man hier dem zunehmenden Verfall des künstlerischen Handwerkes, der sich seit etwa der Mitte der sechziger Jahre auch in Ostdeutschland vollzog, nicht gefolgt war. Sondern im Gegenteil dazu gerade die Betonung des Handwerklichen (was damals in Deutschland nicht nur belächelt wurde) als einen wichtigen Teil der künstlerischen Arbeit sah. Ob bewusst oder unbewusst, mag dahingestellt bleiben. Vielleicht war es die Messe, die den Künstlern für deren handwerkliche Arbeit zweimal im Jahr gute Verdienstmöglichkeiten bot. Vielleicht war es die Tradition, die aus der Buchgestaltung herkam, die auch weiterhin Bestand hatte an der Hochschule und in der Stadt. Vielleicht war es ein genereller Moment, der der Stadt eigen ist und schon bei Klinger festzustellen war, und zwar in Verbindung mit einer Neigung zum Surrealen betreffs der thematischen Gestaltung der Bildwerke. Was Klinger sehr stark mit der Wiener Sezession am Ende des 19. Jahrhunderts verband. Hier gibt es Wurzeln, die bis in die Leipziger Schule reichen, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass es zeitgleich zum Wiener Phantastischen Realismus eine ähnliche Entwicklung aus den frühen fünfzigerJahren heraus auch in Leipzig gab. Und das nicht nur im Hinblick auf die Betonung des Handwerks, das mitunter fast meisterlicher ist bei einigen Leipzigern denn bei den Wienern: Wenn man dabei an Tübke denkt, Dornis, Günter Richter oder auch Rink, Stelzmann, Münzner und Zettl, Hans Peter Müller, Wolfgang Peuker, Zander, Löbel, Thiele, Glombitza, Kissing, Wagenbrett oder Triegel usw. Aber nicht nur bei den magischen Veristen, wie ich sie gerne nenne, wurde Wert auf das Handwerkliche gelegt, sondern auch bei den Postexpressionisten wie Heisig, Gille, Hartwig Ebersbach, Annette Schröter, Christel Göthner oder den postimpressionistischen Koloristen wie Müller-Simon, Heinz Müller, Möbius, Günter Albert Schulz, Heinz Wagner, Pötzschig usw. Auch bei den Konstruktiv/Konkreten wie Martin, Harry Müller oder Meinel ist das deutlich zu verzeichnen, und es hält an bis in die Gegenwart, wenn man an die jüngsten Werke eines Krauskopf oder Novaky denkt. Ebenso bei Künstlern, die sich schwerer in eine übergeordnete Stilrichtung einordnen lassen, wie Mattheuer, Sylvester, Wolfram Ebersbach oder Grimmling. Oder Zeichnern wie Ruddigkeit, Mattheuer-Neustädt und Schultheiß. Am deutlichsten wird das, wenn man sich die Kupferstiche von Baldwin Zettl, die Schablithografien von Rolf Münzner oder die Holzstiche von Karl Georg Hirsch vor Augen führt. Dort geht handwerkliches und künstlerisches Vermögen in einem so hohen Grade ineinander über, dass sich eine Qualitätsebene ergibt, die in der Welt unserer Tage nur wenig Vergleichbares finden lässt.
Bei den großen DDR-Kunstausstellungen in Dresden, spätestens bei der VII., 1974, war dies bereits unübersehbar und wurde auch von einigen interessierten Beobachtern aus dem Westen wahrgenommen. Wer wollte, hat es aber bereits früher erkennen können, anlässlich der legendären Kunstausstellung 1968 in Leipzig, zum zwanzigsten Jahrestag, im Messehaus am Markt, als mit einem Paukenschlag das Politbüro aufgeschreckt wurde, voller Bestürzung über das, das sich da in dem seit der Säuberungsaktion der Kunstakademie 1950 als sicher geglaubten Leipzig in aller Stille entwickelt hatte und überhaupt nicht mehr ins Bild der gewünschten Staatskunst passte, von einigen Ausnahmen abgesehen.
Der Begriff der Leipziger Schule bezieht sich also nicht auf einen gemeinsamen Stil. Das würde auch der Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts entgegenstehen, denn das zwanzigste Jahrhundert zeichnet sich nicht durch einen einheitlichen Stil aus, sondern durch ein gleichberechtigtes Nebeneinanderwirken fast aller denkbaren Stilformen, die uns bekannt sind. Und so verhält es sich auch in Leipzig. Es lassen sich hier unzählige Stilformen finden über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinweg. Aber ich denke, es gibt mit der Betonung des Handwerklichen etwas Gemeinsames, das alle mit der Stadt und ihrer Region verbindet und sie dadurch auszeichnet, und somit den Begriff der Leipziger Schule durchaus berechtigt. Man schenkt den Dingen eine andere Aufmerksamkeit, wenn man hört, dass sie aus Leipzig kommen. Ich denke, das gilt für Galerien wie Dogenhaus und Eigen+Art ebenso wie für die Hochschule. Und die Galerie für Zeitgenössische Kunst ist auch nicht von ungefähr hier ansässig und nicht in Berlin.
IV.
Es ist dies ebenso nicht allein nur das Ergebnis der ersten freien Malklasse und des damit verbundenen Dranges bemerkenswerter Talente an die Hochschule für Grafik und Buchkunst. Hinzu war noch ein anderer Umstand gekommen, der prägenden Einfluss hatte. Der Mauerbau 1961 trennte diesen kleinen Teil Deutschlands in beängstigendem Maße ab von der Weltkulturentwicklung, dass vor allem die Jungen nach Auswegen suchten und sie fanden. Zum Beispiel in der Entdeckung der russischen Revolutionskunst von 1917 bis 1923. Denn da waren sie alle wieder, die dem zwanzigsten Jahrhundert so große Impulse in seiner Kunstentwicklung gegeben hatten: Kandinsky, Malewitsch, Lissitzky oder in der Literatur Isaak Babel, Michail Bulgakow. Damit war wenigstens ein indirekter Bezug zur klassischen Moderne gegeben. Sowie man sich über die proletarisch-revolutionäre Kunst den Weg frei legte zu den Veristen und magischen Realisten. Und von dort war der Sprung zu den Surrealisten, Expressionisten und auch Impressionisten nicht weit. Sowie es ohnehin in Sachsen von fast alldem eigene bemerkenswerte Traditionslinien gibt.
Aus Angst gänzlich abzudriften in die kleinbürgerliche, sozialistische Kulturprovinz, war man mitunter näher an den Kunstentwicklungen des Westens als der Westen selber. Was dort zum Beispiel unter dem Begriff die „Jungen Wilden“ um 1980 einen kurzen Höhenflug erlebte, das ließ sich zehn Jahre zuvor, um 1970, schon in Leipzig erleben mit Künstlern wie Hartwig Ebersbach, Hans Hendrik Grimmling, Frieder Heinze, Lutz Friedel, Lutz Dammbeck, Wolfgang Biedermann, Günter Huniat, Olaf Wegewitz, um nur diese zu nennen.
In der DDR war immer gleich alles mit politischen Vorzeichen versehen und so war der Blick meist verstellt auf die ganz normalen zwischenmenschlichen Abläufe, wie eben der Tatbestand der Leipziger „Jungen Wilden“, der seinen Ursprung nicht im Politischen besaß, sondern das Aufbäumen der Jungen gegen die inzwischen etablierten Alten war. Und das waren Heisig, Tübke, Mattheuer, Gerhard Kurt Müller, Dietrich Burger usw. Vor allem die mächtigen Vatergestalten Heisig, Mattheuer, Tübke oder auch Gerhard Kurt Müller, die vor allem auch künstlerisch etwas entgegen zu setzen hatten, reizten gerade die kraftvollsten unter den Jungen, sich an und mit den Alten zu messen. Was auf beiden Seiten nicht selten mit aller Kraft betrieben und ebenso recht lustvoll ausgekostet wurde. Gleich welche Gesellschaftsordnung damals den Alltag bestimmt hätte, dergleichen wäre so und so geschehen. Da waren die künstlerischen Potenziale einfach zu stark und die Charaktere zu gleich. Um so bedauerlicher ist es, dass damit eine der aufregendsten Kunst- und Künstlerentwicklungen in Deutschland, und man könnte es getrost auf Europa ausdehnen, dass diese, noch immer durch politische Sichtweisen verunklärt, nicht so recht erkannt wird. Und leider tragen die Betroffenen, die Künstler, ihr Scherflein mit dazu bei. Und das geschah schon damals, indem die einen es halt besser verstanden, sich die Begierden des Staates zu Nutze zu machen. Und andere wiederum oft selbst wieder einrissen, was sie sich aufgebaut hatten. – Beide taten es aber meist ohne einen Deut ihrer Kunst preiszugeben.
Das alles erreichte Ausmaße, die spätestens ab den achtziger Jahren staatsprägend wurden. Es gab kaum noch eine Kunsthochschule in der DDR, die dann nicht von Künstlern dominiert wurde, die aus Leipzig kamen. Im Verband Bildender Künstler hatten einige eine Machtfülle erreicht, die sie zwangsläufig zuweilen zu jenem zwischenmenschlichen Machtmissbrauch führte, den seit den Tagen des Alten Testamentes noch immer alles Fleischliche gegangen ist, so man ihm die Gelegenheit gab. Und so groß die Verdienste jener in den siebziger Jahren auch waren, als es einem kleinen Häufchen um Sitte, Heisig, Paris und Jastram gelang, für die Mitglieder des Künstlerverbandes beachtliche Privilegien vom Staate zu ergattern, so hart hatte dann in den Achtzigern manch anderer darunter zu leiden, dessen Malstil (weniger dem Staate) aber um so mehr den machtbeherrschenden Künstlern und deren Zuträgern missfiel, aus welchen Gründen auch immer. Und auch dies ist nichts DDR-Spezifisches, sondern wenigstens seit der Renaissance allzu bekannt und findet unter den Künstlern der Neuzeit gnadenlos statt, sobald es die Umstände erlauben.
Es ist auch falsch zu behaupten, dass unter Diktaturen keine Kunst entstehen kann. Gerade innerhalb der Kunstentwicklung der DDR wurde sichtbar, dass es eigentlich heißen muss: So sehr sich eine Diktatur auch bemüht, es ist ihr nicht möglich, Kunst generell zu verhindern. Unsere Kenntnisse über Diktaturen sind in den letzten 150 Jahren sehr umfangreich geworden. Und eines lässt sich dabei zuerst feststellen: Alle Diktaturen wollen ganz schnell die Kunst für sich gewinnen, und zwar in einem ihr genehmen manipulierenden Sinne, denn Kunst wirkt bildungsunabhängig, sie erreicht alle Schichten und Klassen; und derer will man habhaft werden. Aber gerade an diesem Verlangen der Diktaturen kann man die Entdeckung machen, dass es von Natur aus dem Menschen nicht möglich ist, Kunst zu manipulieren. Sobald er es versucht, zerrinnt sie ihm zwischen den Fingern, wandelt sie sich sichtbar, zu einem ziemlich miesen Ersatzprodukt. Das gab es auch in der DDR. Aber die Kunstentwicklung dort bestand nicht ausschließlich aus dergleichen Ersatz-produkten, sondern zu einem weit größeren Teil bestand sie aus jenen künstlerischen Leistungen, die sich eben trotz aller diktatorischer Maßnahmen nicht verbiegen lassen. Im Gegenteil, aus Gründen dieses wahnsinnigen Druckes durch die Politik einerseits, aber auch aus dem Grund, dass, wer seine Nische gefunden hatte, auch die Zeit besaß, die man braucht, um ein Werk genügend tief ausloten zu können, bevor man es abschließt und in die Welt entlässt. Aus eben diesen Gründen ist manches entstanden, das aller ernst zu nehmenden Kritik standhalten wird, vor allem in Hinblick auf zukünftige Generationen. Und Leipzig war dafür ab Beginn der siebziger Jahre ein Zentrum, das sich im Laufe der folgenden Jahre und bis in diese Tage zu einer Hochburg bildender Kunst entwickelte, wie es das in seiner Art im Augenblick in ganz Deutschland kein zweites Mal gibt.
V.
Natürlich ist nicht nur der Gedanke daran für manchen gewöhnungsbedürftig. Auch die Kunst, die es betrifft, passt nicht in all ihren Positionen auf den ersten Blick in die geläufigen, momentanen Sehgewohnheiten. Sowie es wundersam genug ist, bei aller zeitlichen Offenheit zur Zukunft hin, durchaus von einem Quantum abgeschlossener Kunstgeschichte sprechen zu können, mit einem Anfangs- und einem Enddatum: 1949 – 1989. Das gab es in der bisher bekannten Kunstgeschichte, vergleichbar, nur ein zweites Mal: Es handelt sich dabei um die Entwicklung der bürgerlich-holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, als man dort gleichsam, wenn auch nur für dreißig Jahre, fast hermetisch von der europäischen Kunstentwicklung abgeschlossen war und auf sich gestellt, eine eigene Färbung der barocken Bildsprache entwickelte. Als dann Ludwig der XIV. zum ersten Male Bilder dieser Epoche zu Gesicht bekam, war er entsetzt. – Sind wir es ebenfalls, angesichts der Werke eines Rembrandt, van Goyen, van Delft oder Brouwer und all der anderen? Müsste es nicht vielmehr nachdenklich machen, dass einer der vielversprechendsten internationalen Newcomer, Neo Rauch, von hier kommt?
VI.
Als der Zweite Weltkrieg 1939 begann, waren wichtige Entwicklungen der deutschen Kunstgeschichte so gut wie spurlos an Leipzig vorübergegangen. Die Übergestalt Max Klingers hatte auch noch nach seinem Tode 1920 in Leipzig nichts aufkommen lassen. Weder Expressionismus, Verismus oder Einflüsse des Bauhauses kamen zur Entfaltung. Der Zweite Weltkrieg war aber noch nicht richtig zu Ende, als sich in der Stadt zwei Dinge der Kunst zu regen begannen: der Jazz und eine euphorische Hinwendung zum Bauhaus unter der Jugend. – In dem Kreis, der sich nach Kriegsende zum Beispiel um die Architekten Herbert Becke und Fritz Haller versammelte, wurde nicht nur der Jazz gepflegt, sondern es wurden Bauhausmöbel nachgebaut, Wohnungen ganz im Stile des Bauhauses eingerichtet bis hin zur Bemalung der Wände und dem Wandschmuck selbst. Auch bei der Messe waren auf Betreiben des Messemannes Ruge bis 1954 die Gestaltungen der Messestände gänzlich am Bauhaus orientiert. Und es wurden für die Ausgestaltung alle Bauhausleute verpflichtet, derer man nur habhaft werden konnte. Die Bewegung war so stark, dass selbst die ersten beiden Häuser der berüchtigten Stalin-Allee in Berlin-Ost im Stile des Bauhauses errichtet wurden. Und noch bis zur Wende konnte man auf dem Gelände der Alten Technischen Messe in Leipzig den von Becke gebauten Turm betrachten, welcher der berühmten Rednertribüne von Lissitzky nachempfunden war. (Leider sind alle Gebäude, die Becke im Bauhausstil nach dem Kriege auf der Technischen Messe baute, die ersten gewesen, die nach der Wende abgerissen wurden.)
VII.
Es gibt noch unzählige Faktoren zur Entwicklungsgeschichte der Leipziger Kunst, die der Aufarbeitung harren. Und zwar unter dem Aspekt einer ideologiefreien Betrachtung. Es ist z. B. noch wenig darüber nachgedacht worden, welche Auswirkungen auf die Leipziger Kunstentwicklung die berüchtigten Säuberungsaktionen besaßen, die im Zuge des aufstrebenden kalten Krieges 1950 an den Kunstakademien der Ostzone stattfanden. Und wobei sich Leipzig durch großen Eifer unter der Ägide von Masslow und Magritz besonders hervortat und, wie bereits erwähnt, sich für den Rest der fünfziger und einen Teil der sechziger Jahre einen äußerst schlechten Ruf einhandelte. Hassebrauk und Schwimmer z. B. gingen in diesem Zusammenhang nach Dresden. Martin und Trauzettl z. B. mussten die Schule verlassen aufgrund ihrer künstlerischen Auffassungen. Und wie so manch andere auch, ging ein Teil wie z. B. Trauzettl in den Westen, um dort fertig zu studieren, während der andere Teil wie z. B. Martin im Untergrund verschwand.– Dem im Übrigen einzig wirklichen Untergrund, den es zu DDR-Zeiten gab, denn nur diese Generation hat einen 16 großen Teil ihres künstlerischen Daseins dort verbringen müssen. Und nicht wenige hatten bald gänzlich unter dem Druck der vollkommenen Isolation und des Geldmangels aufgehört zu malen. Aber nicht alle.
VIII.
Betrachtet man das Ausstellungsangebot der fünfziger Jahre, soweit es durch Kataloge noch möglich ist, so könnte man denken, dass da in Leipzig nichts Bemerkenswertes geschehen ist. Begibt man sich aber in die Ateliers und privaten Sammlungen und kramt sich bis in jene Jahre vor, dann entsteht ein überraschend anderer Eindruck: Manfred Martins konstruktiv/konkretes OEuvre ist zwar nicht über die Maßen groß, aber, soweit noch vorhanden, bereits damals sehr dicht und zeitlich sehr nahe an der internationalen Entwicklung dieser Stilrichtung. Müller- Simons erste Arbeiten nach dem Studium leben von einer lyrischen Expressivität, die erst Anfang der siebziger Jahre durch Künstler wie Firit und Friedel auch öffentlich bewusst wird. Tübke nähert sich über vor Ort empfundene Landschaften, denen man die fünfziger Jahre noch ansieht, seinem späteren Stil, der ihn berühmt macht. Kurze Zeit davor hatte er noch mit Picassos Blauer Periode geliebäugelt. Mattheuer wandelt sich um 1956 fast ohne Vorspiel vom Gebrauchsgrafiker zu einem Maler, dessen Handschrift vom ersten Bilde an eine malerische und stilistische Sicherheit erkennen lässt, wie das in dieser Urplötzlichkeit des Geschehens ganz selten zu finden ist. In Heinz Müllers stillem Atelier am Rande der Ostvorstadt entstehen, neben den sensiblen Stadtrandlandschaften, die man von ihm kennt, vor der Öffentlichkeit bis heute gehütete abstrakte Arbeiten, die den Landschaften und Stillleben in nichts nachstehen.
Und noch ein anderer gibt bereits in den fünfziger Jahren klar und eindeutig zu erkennen, welchen künstlerischen Weg er gehen wird: Gerhard Altenbourg. Und damit lässt sich davon ausgehen, dass die Fehde zwischen Altenbourg und einem gewichtigen Teil der Leipziger Szene, die mitunter kulturpolitische Dimensionen annahm, von Anbeginn an zur Entwicklung der Leipziger Schule gehört. Und eigentlich nie endete. Denn als man sie hätte beilegen können, starb Altenbourg 1989 bei einem Autounfall. Aber unübersehbar ist sein Einfluss auf einige der späteren Generationen der Leipziger Schule.
Ich denke, man kann ohne Verbiegungen eine Entwicklung aufzeigen, die mit ihren Wurzeln in den späten vierziger Jahren verankert ist, und dann in einem sich gegenseitig beeinflussenden Wechselspiel der künstlerischen Ansichten bis in die heutigen Tage reicht, hinweg über die späten vierziger mit ihrer Aufbruchsstimmung; hinweg über die dunklen fünfziger Jahre mit ihren ersten zukunftsweisenden Spitzen; die wilden sechziger mit ihren Auseinandersetzungen, aber auch befruchtenden Momenten zwischen Alten und Jungen; die erfolgreichen siebziger, in denen sich die Leipziger Schule emanzipierte (ohne dass die Auseinandersetzungen aufhörten); hinweg über die reichen achtziger, als z. B. unter anderem über die Galerie Eigen+Art die Leipziger Kunstentwicklung einen weiteren, sie bereichernden Schub erfuhr und die erste internationale Aufmerksamkeit zu verzeichnen war; und hinweg über die neunziger, als man dieser Entwicklung nachweisen wollte, dass sie eigentlich keinerlei Bedeutung besitzt. Was im Weiteren niemanden daran hinderte, die ersten bedeutsamen Sammlungen zu beginnen. Sowie selbst unter den Jüngsten, die an der Schule studieren, auch weiterhin begeisternde Talente zugegen sind.
IX.
Vieles ist also bisher in Bezug auf die Entwicklung der Leipziger Schule noch nicht im rechten Licht besehen worden. Dass dies für die kommenden Zeiten möglich wird, das ist eines der Hauptanliegen der Kunstsammlung der Sparkasse Leipzig. Und erste Aufarbeitungen dafür zu leisten, das wird das vorrangige Anliegen ihrer Kunsthalle sein. Und dabei wird es nicht darum gehen, zu urteilen und eine Kunstgeschichte vorzugeben nach eigenem Gutdünken oder anderen gegenwärtigen, zeitgebunden Maßstäben. Sondern es sollte darum gehen, möglichst viel authen-tisches Material zu bewahren, damit sich zukünftige Generationen selbst ein Bild machen können, unvoreingenommen von unseren gegenwärtigen, nicht selten durch mancherlei Befangenheit beeinflussten Ansichten.
Leipzig, im Januar 2001
Claus Baumann